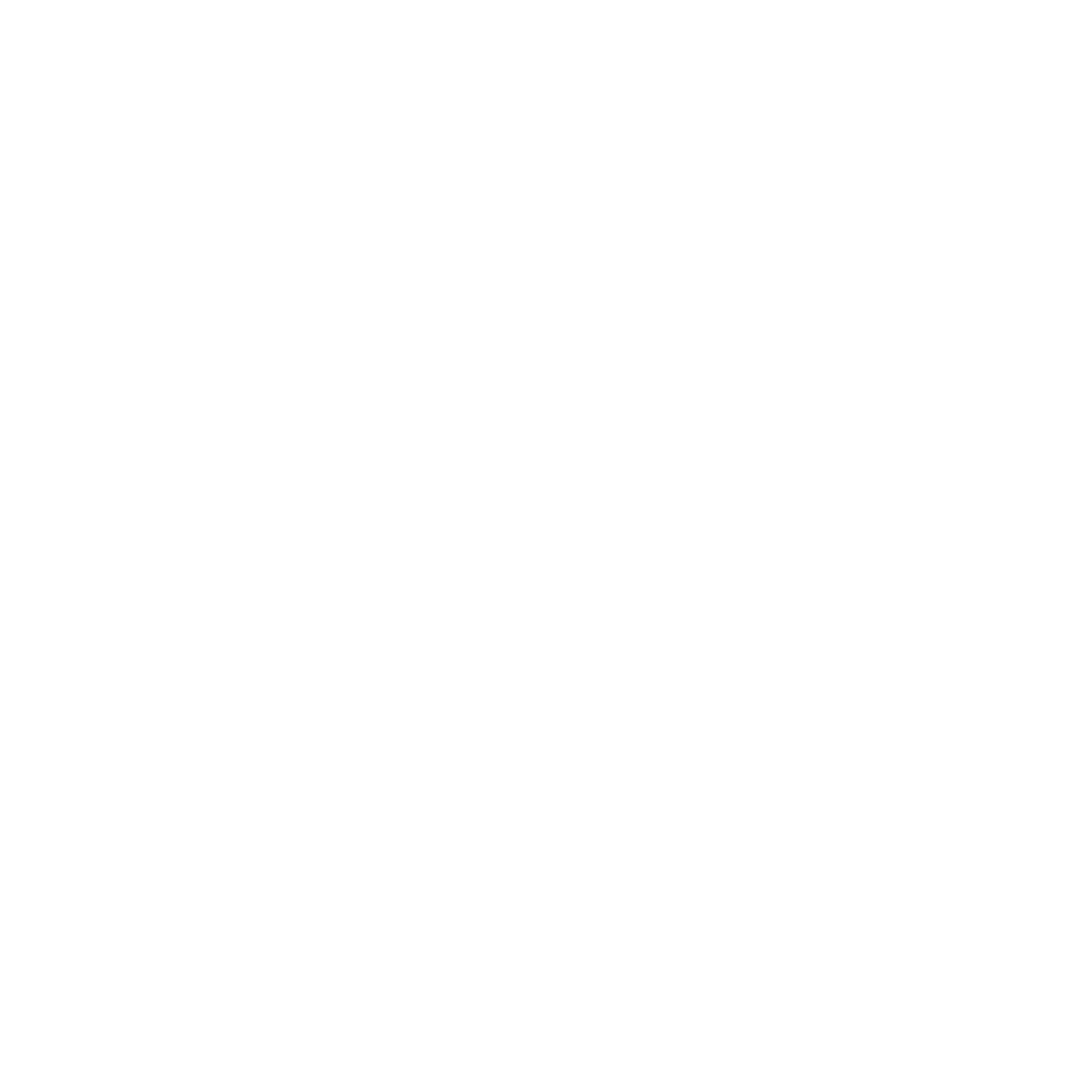Antifaschismus aus Notwendigkeit
Mein Leben in Sachsen
Inhaltswarnung: Rassismus, Gewalt, Alkoholkonsum, Erwähnung von Sekten
Text als Hörfassung: ▶️ Antifaschismus aus Notwendigkeit.mp3 (10 min 52 s)
Das Gras zwischen meinen Händen, welches ich die ganze Zeit nervös aus dem Rasen zupfe, ist warm und verbreitet einen angenehmen Geruch. Ich bin 15 und sitze an einem sonnigen Frühsommernachmittag in einem Park in Hoyerswerda, mir gegenüber der Junge, in den ich mich das erste Mal so richtig verlieben werde. Mit der Zeit tauen wir etwas auf, unsere Gitarren liegen neben uns und wir reden über Musik, ich zeige ihm einige meiner Zeichnungen und wir kriegen uns nicht mehr ein, als seine Bierflasche über einer Ausgabe des Wachturms ausläuft, die uns kurz zuvor eine ältere Zeugin Jehovas gegeben hat.
Mein Herz schlägt wie wild vor Aufregung und Freude – bis von einer anderen Ecke des Parks plötzlich Gegröle und Rechtsrock ertönt und ich wirklich Schiss bekomme.
Wo es keine Ausländer·innen gibt, werden "Zecken geklatscht". Eine simple und bittere Wahrheit. Und wir sehen aus, wie die letzten Hippies. Er mit dem löchrigen Pulli, der abgeschnittenen Jeans und den langen Haaren und ich mit dem bunten Karohemd, den vielen Armbändern und den bemalten und geflickten Billig-Chucks. Der Junge beruhigt mich, der Park ist mittelmäßig gut besucht, wir sind also nicht allein, die Gruppe Bilderbuch-Neonazis mit Glatzen, Bomberjacken und einem Bollerwagen wankt angetrunken und pöbelnd ein ganzes Stück weit entfernt von uns vorüber und meine Angst weicht einem neuen Gefühl: Wut. Wut, darüber, dass diese Typen mir solche Angst machen können, obwohl wir uns nicht mal gegenüber standen. Wut darüber, dass ich noch viel mehr Angst hätte haben müssen, wenn ich zufällig eine andere Hautfarbe gehabt hätte. Aber vor allem Wut darüber, dass es so normal ist, hier einer Gruppe Faschos zu begegnen.
Dieser Nachmittag hat mich geprägt. Er hat mir nicht nur langfristig den heftigsten Liebeskummer beschert, den ich wohl je durchgemacht habe, er hat mich auch politisiert. Ich wollte es nicht mehr hinnehmen, dass mir Nazis solche Angst machen können.
Knapp 15 Jahre später lebe ich in Dresden, der Hauptstadt von Sucksen (Kunstwort aus engl. to suck - zum Kotzen bzw. ätzend sein und Sachsen). Oft fehlt mir die Kraft, mich gegen den braunen Mob zu stellen, viel zu selten bin ich bei den Montags-Gegendemos und zu oft gehe ich nicht dazwischen, wenn der hundertste rassistische Witz zu hören ist. Der Kampf gegen Rassismus ist einfach eine ganz besondere Windmühle, die viel abverlangt. Doch Aufgeben ist keine Option. War es noch nie.

Nach diesem besonderen Nachmittag im Park, wuchs der Wunsch in mir, möglichst bald weg zu ziehen. Damals kam mir noch alles besser vor, als das ostsächsische Hinterland, in dem ich lebte. Bis zum Abitur waren es jedoch noch einige Jahre hin und ich erlebte noch die Nachrichten der Fackelzüge in Radeberg, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, rassistische Anfeindungen einer Lehrerin gegenüber Schülerinnen mit Migrationshintergrund und die berühmten CD-Verkäufe von Neonazis vor Schulen mit. Damals lernte ich, langsam Worte für meine Wut zu finden, diskutierte viel mit Freund·innen und wurde mir darüber bewusst, was es bedeuten kann, sich auch in den Kleinstädten und nicht nur auf großen Demonstrationen mit Neonazis anzulegen. Vermutlich werde ich nie vergessen, wie mir ein Freund damals sagte, dass er sich keine Beziehung vorstellen kann, so lange er antifaschistisch auf der Straße aktiv ist. Sein Leben sei einfach zu gefährlich. Das klingt heute sehr pathetisch, schließlich waren wir Teenager. Aber so ganz unbegründet waren diese Gedanken nicht. Auch ich habe montags seine blauen Flecken und Schrammen vom Wochenende gesehen.
Nach dem Schulabschluss ging es dann 2011 nach Leipzig. Ja – immer noch Sachsen, aber dafür direkt nach Connewitz! In einer viel zu kleinen Wohnung zu zweit zwischen dem Conne Island und dem Werk 2, lebte ich in einer Blase aus weltoffenen Freund·innen, den neuen Freiheiten einer großen Stadt und der Uni. Ich habe mein Viertel geliebt, meine linke Hochburg, in der ich mich auch nachts allein auf die Straße getraut, mir das erste Mal die Haare grün gefärbt und mich frei gefühlt habe. Um trotzdem etwas gegen die „Nazis anderswo“ zu machen, fuhr ich jedes Jahr zum 13. Februar mit dem Demobus nach Dresden. Wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet bin ich, als ich wegen der ständig steigenden Mieten 2 Jahre später nach Stötteritz, einem Viertel im Südosten der Stadt, direkt neben Reudnitz, gezogen bin. Dort sind mir in der Straßenbahn Menschen mit einer 88 auf dem Fahrrad begegnet und ich habe mich nicht mehr sicher in meinem neuen Viertel gefühlt und im Zweifel wieder die Klappe gehalten. Und dann kam 2015, dann kam LEGIDA.
Die ersten Wochen waren noch aufregend, Tausende waren bei den Gegenprotesten, ich habe mein erstes LED-beleuchtetes Schild gebastelt und wir waren mit einer großen Freund·innen-Gruppe unterwegs. Jeden Montag. Doch mit den Monaten wurden wir weniger, ein befreundetes Paar ist in der Zeit sogar schwanger geworden. Das Leben ging weiter und trotzdem versammelten sich erst tausende, dann hunderte „besorgte Bürger·innen“ und irgendwann nur noch Neonazis in der Innenstadt, denen wir nicht den Platz überlassen wollten. Die Parolen und Reden wurden radikaler und immer absurder. Die Weiße Rose hätte sich gegen die „Islamisierung“ gewährt. Es würden Schweinefleischverbote in ganz Deutschland kommen. Und nicht zu vergessen, die Hitlergrüße.
Ich konnte den Gegenprotesten einfach nicht fern bleiben, auch wenn ich nach einigen Monaten nur noch allein, ohne meine Bezugsgruppe, unterwegs war. Natürlich hatte ich ein mulmiges Gefühl, besonders bei der Abreise abends. Aber die Alternative, nichts zu tun, kam für mich nicht in Frage und so hat mir LEGIDA über Jahre meine Montage gestohlen, bis die Demos endlich nachließen.
Mir ist klar, dass rechtes Gedankengut nicht verschwindet, nur weil nicht mehr jeden Montag demonstriert wird. Und natürlich nützen Diskussionen am Rande einer Demonstration darüber, dass alle Menschen ein Recht auf ein sicheres Leben haben, vermutlich so gut wie gar nichts. Aber es hat sich sehr wie ein Erfolg angefühlt, als bundesweit die Montage wieder zu normalen Wochentagen geworden sind. Na ja, fast überall. Schließlich gibt es da ja Dresden.
Dresden. Es ist so einfach, Leipzig zu lieben. Dresden hingegen sträubt sich mit jeder Faser davor, auch nur gemocht zu werden. Ich habe sehr lange gebraucht, um hier anzukommen. Und ich habe mich zuvor ebenso lange geweigert, überhaupt hier her zu ziehen, habe es dann aber doch für meinen damaligen Partner getan. Jetzt lebe ich schon fast 5 Jahre lang hier und es hat sich eine Art Hassliebe zwischen dieser Stadt und mir entwickelt. Kaum Parks oder Stadtteilkultur, dafür aber fast jeden Montag Naziaufmärsche und die altbackene Einstellung der „Kulturstadt“.
Meine persönliche Rettung kam Anfang 2019, nachdem ich bereits über ein Jahr lang in Dresden gelebt hatte, auf einer Polizeigesetz Stoppen Demo. Wieder einmal allein auf einer Demo unterwegs, bin ich sehr lange um eine kleine Gruppe Pirat·innen herum gestrichen. Sie hatten ein großes selbst bemaltes Transparent mit einem Papageien darauf, der auf eine Kamera kackt und unter dem die Worte: „Scheiß auf Überwachung“ standen, dabei. Als ich meinen Partner dann doch noch am Telefon überreden konnte, vorbei zu kommen, erzählte ich ihm von der Gruppe, die ich die Demo über beobachtet hatte und er ermutigte mich, sie doch ganz am Ende der Veranstaltung anzusprechen. Ich wurde daraufhin standesgemäß erst einmal mit Stickern versorgt und es wurden Mail-Adressen ausgetauscht. Am 06.02.2019 war ich dann das erste Mal bei einem Hochschulpirat·innen-Treffen dabei und das war das Beste, was mir passieren konnte.
Ich war nicht mehr allein mit meinen Ideen, meiner Angst, der Wut und der Hoffnung, doch etwas verändern zu können. Gruppen sind so wichtig. Ohne meine politische Familie, würde ich wohl an dieser Stadt kaputt gehen. Klar, es gibt überall gute Leute, aber das sind meine guten Leute. Die konkrete Arbeit an Themen, wie dem sicheren Hafen für Dresden, hilft mir sehr. Nach und nach habe ich auch immer mehr Kontakt zu anderen Gruppierungen aufgebaut, bin immer mehr hier angekommen und auch wenn ich mir das lange nicht hätte vorstellen können, ist Dresden mein zu Hause geworden. Mein zu Hause, um das ich mich kümmern will, dass ich besser machen will, für das ich kämpfen will.
Manchmal weiß ich immer noch nicht, wie ich mich verhalten soll, wenn mir eine Gruppe Hools begegnet. Oder es fehlt mir die Energie, über Alltagsrassismus aufzuklären. Aber über die Jahre und durch die Unterstützung der Gruppe ist mein Fell dicker geworden und ich stelle mich den Diskussionen, dass PEGIDA oder die AfD doch gar nicht so schlimm seien, wir uns die Aufnahme von Geflüchteten nicht leisten könnten oder das N-Wort doch keine Beleidigung wäre. Zumindest meistens.
Und wenn ich es mal nicht schaffe, dann weiß ich, dass ich nicht allein bin und andere die gleichen Schlachten zusammen mit mir schlagen. Denn egal wie schwer es manchmal ist und so sehr ich alle verstehe, die weg ziehen, Dresden ist jetzt mein zu Hause und ich kann es nicht aufgeben. Denn wer soll sich darum kümmern, wenn nicht wir?